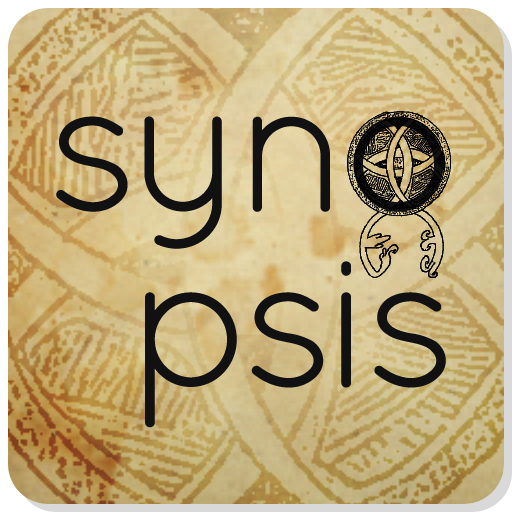Inhaltsverzeichnis
GRADUALE 2
GR2 INC
 Grundsätzlich zweiakzentiger Cento „Éx-cita dó-mine“, der auf „re“ rezitiert. Ist der erste Akzent der wichtigere, so beginnt er mit dem kTrc „do-mi-re“ (sol-si-la : Trc validus) die Rezitation umspielend. Ist der erste Akzent weniger wichtig, so steigt der Cento syllabisch auf („A-do-re“), wobei dieser schwache Akzent auf dem „do“ (sol) liegt. Sind sowohl der Anfangs- als auch der Schlussakzent Hauptakzente, so ist dem ersten Akzent „do“ (sol) ein zusätzlicher kPes aufgesetzt, so entsteht ein Sca 1-3 (scandicus mit Anfangsartikulation.
Grundsätzlich zweiakzentiger Cento „Éx-cita dó-mine“, der auf „re“ rezitiert. Ist der erste Akzent der wichtigere, so beginnt er mit dem kTrc „do-mi-re“ (sol-si-la : Trc validus) die Rezitation umspielend. Ist der erste Akzent weniger wichtig, so steigt der Cento syllabisch auf („A-do-re“), wobei dieser schwache Akzent auf dem „do“ (sol) liegt. Sind sowohl der Anfangs- als auch der Schlussakzent Hauptakzente, so ist dem ersten Akzent „do“ (sol) ein zusätzlicher kPes aufgesetzt, so entsteht ein Sca 1-3 (scandicus mit Anfangsartikulation.
 Der letzte Akzent trägt ein 9-stufiges (10-toniges) Melisma. Ist das letzte Wort ein PPO, so löst sich das resupine „mi“ (si) vom Melisma ab und bildet mit dem Tenorton „fa“ eine Clivis auf der Binnensilbe. Ist die letzte Silbe ebenfalls akzentuiert (Oxytonon „honoráti súnt“), so wird auf die verbindende Clivis verzichtet.
Das Gradual-Incipit der Osterwoche „Haec dies“ ist mit dem Norm-Cento melodisch eng verwandt, übersteigert ihn aber einerseits bereits auf der ersten Silbe „Haec“ zum „do“, andererseits verzichtet der Schluss auf das resupine „si’; die kurrente Bewegung „la-sol-la-sol“ treibt den Sprachfluss auf den nächsten Cento hin weiter.
Der letzte Akzent trägt ein 9-stufiges (10-toniges) Melisma. Ist das letzte Wort ein PPO, so löst sich das resupine „mi“ (si) vom Melisma ab und bildet mit dem Tenorton „fa“ eine Clivis auf der Binnensilbe. Ist die letzte Silbe ebenfalls akzentuiert (Oxytonon „honoráti súnt“), so wird auf die verbindende Clivis verzichtet.
Das Gradual-Incipit der Osterwoche „Haec dies“ ist mit dem Norm-Cento melodisch eng verwandt, übersteigert ihn aber einerseits bereits auf der ersten Silbe „Haec“ zum „do“, andererseits verzichtet der Schluss auf das resupine „si’; die kurrente Bewegung „la-sol-la-sol“ treibt den Sprachfluss auf den nächsten Cento hin weiter.
. 0247 Der Cento GR2 if deutet den Text „faci-em túam“ mit einem Melisma aus.
. 0276 Auch die Variante „Tecum prin-cipium“ ist der Textausdeutung geschuldet. Eigentlich eine bloße Rezitation auf der festen Stufe der Finalis ist die Silbe „princi-pi-um“ eine einfache Umspielung des „la“ (re). Der Quarsprung nach unten „la-mi-la“ ist ein Intervall der Kraft. Das Schlussmelisma „in die“ ist das selbe wie in 0247, nur beginnt es mit Bivirga (!) statt der weitertreibenden Porrectus-Bewegung.
. 0253 Der Cento endet im unteren Tonraum des 2. Modus „fa-do“ (sa-fa), um Raum zu schaffen für ein von unten aufsteigendes „misericordiam tuam“.
GR2 MED
📘 📙 📗 📕

 Der Cento GR2 MED endet grundsätzlich mit einem 15-tonigen Melisma auf der letzten Silbe. Den letzten Akzent markiert ein PrrFlxRes (Porrectus flexus resupinus) „sol-fa-la-sol-la“. Bei PPO („domine”) wird ein Prr auf der Binnensilbe eingeschoben. Bei Oxytonon (O) verschmelzen Akzentneume und Melisma (e.g. 0171).
Der Cento GR2 MED endet grundsätzlich mit einem 15-tonigen Melisma auf der letzten Silbe. Den letzten Akzent markiert ein PrrFlxRes (Porrectus flexus resupinus) „sol-fa-la-sol-la“. Bei PPO („domine”) wird ein Prr auf der Binnensilbe eingeschoben. Bei Oxytonon (O) verschmelzen Akzentneume und Melisma (e.g. 0171).
Das Incipit unterscheidet, über die Gewichte der Akzente. Bei 'accentus maior finalis'(=f) hat der erste Akzent eine Clivis supratripunctis (ClvSpp3) „do-la-do-re-mi“. Die Grundstruktur bilden die drei Neumen ClvSpp3, kClm „do-si-la“ und die kPrrSbp „la-sol-si-la-sol“. Bei Oxytonon verschmelzen Clm und PrrSbp zu einer Neume (0171, 0200).
In 0234 verschmelzen zwar die Silben „su-um“, aber das Wort ist kein Oxytonon, Clm und PrrSbp bleiben deshalb getrennt. In 0239 verschmelzen zwar Clm und PrrSbp, die Schlussakzentneume und das Melisma bleiben aber getrennt. Grund dafür ist der Name „líbani“, ein PPO das mit PO eingeleitet ist. Dem entsprehend wird der Akzent „líbani“ wie eine praetonische Silbe zu Akzentneume behandelt.

Bei dreiakzentigen Texten wird entweder der PrrSbp auf zwei Silben aufgeteilt (0248 „tui“), oder der dritte Akzent als überzählig behandelt, so in 0198 „paupéribus iustítiae“. Das nachgeschobene „eius“ steht nun auf dem Melisma mit einer supervenienten letzten Silbe „la“. Überhaupt ist bei diesem Graduale die Textverteilung etwas ungewöhnlich: „INC Dispersit dedit MED pauperibus iustiatia eius NOV manet in saeculum TER saeculi“. Liegt der Hauptakzent des Cento am Beginn (i), wird eine Neumengruppe eingesetzt, die mit Bivirga „do“ beginnt und auf zwei Silben verteilt ist. In 0217 ist der Cento einakzentig „ín glória“, in 0233 wird der dreiakzentige Text komponiert als seinen es zwei Centones, einer einakzentig, der andere zweiakzentig. Beide Bivirga-Incipites vertonen aber Texte, die mit einem Doppelakzent beginnen: „ín glória“, „éxívit“. In 0276, 0247 und auch im zweiten Teil des MED 0233 ist der 'accentus maior incipiens'(=i) der Gestalt komponiert, dass der Aufstieg „la-do“ in einem nk Stützpunkt „do“ mündet. Es folgt eine k Bewegung „si-re-do-si-(do-)la“.
Das GR2 MED Der Gradualien der Osterwoche verwendet eine Variante von 'i', der weitere Verlauf der Melodie liegt höher als die Norm und endet auf „do“.
Völlig individuell scheint GR2 MED in 0253 „misericordiam tuam“ zu sein.
GR2 NOV
Der Cento GR2 NOV ist zuerst einmal durch ein 31-toniges Endmelisma definiert, das vom Ténor „do“ (fa) zum tiefen „fa“ (Sa) fällt und dabei als Gipfelton das „mi“ (la) erreicht. Das Melisma ist auf zwei Silben aufgeteilt (15 und 16 Töne).
Bei einakzentigen Texten („exultémus“ in der Osterwoche) stehen die beiden praetonischen Silben auf „la“ zum „do“ (re und fa). Entsprechend der psalmodischen Struktur steht am Neuanfang (NOV) des Textes nach der Mediatio oft eine betonte Konjunktion „ét“, „íta“, „pér“. Dem entspricht die Typusmelodie des Protus plagalis mit einer Bivirga auf dem Ténor „fa“ am Beginn des Cento NOV sowohl im Responsorium als auch im Vers.
Zweiakzentige Texte beginnen deshalb mit Bivirga „do“ (fa). Der weitere Text rezitiert auf „do“, bevor mit dem letzten Akzent das Melisma beginnt. . 0253 ist das Wort „salutáre“ ausgeschmückt.
Sind drei Akzente zu vertonen löst sich das Melisma auf. Auf die Bivirga (1.Akzent) folgt eine zweisilbige Formel aus Trc „do-mi-re“ und 3stufigem, 4tonigem Clm „re-do-do-la“. Der Trc trägt meist den 2. Akzent. Die Vartianten dazu erklären sich von selbst: . 0198 „mánet in saeculum“ ist zwar nur 1 Akzent aber die Wortausdeutung ist zwingend. Das Wort beginnt mit einer ausbreitenden Clv. . 0282A „et elevámini portae aeternales“ Die ‚uralten Pforten‘ springen nicht einfach zum „mi“ hoch, sie heben sich mühsam. Auch 0247 GV2 „infixus sum in limo profundi“ ‚ich versinke im Schlamm‘ kann nicht mit einem Sprung nach oben komponiert sein. . 1161 „et lux perpétua“. ‚lux‘ ist zwar ein Akzent, aber er steht im Schatten von ‚perpétua‘. Daher wird der Trc “do-mi-re“ durch die enttonende Melodie „mi-re-do-re-do“ zurückgenommen xx) Vergleiche dazu die Psalmodie der Lamentationes, die jeden Vers mit dierser Tonfolge abschließt))) . Bei drei Akzenten folgt auf auf dem dritten Akzent die nkNeume „do-la-do-re-la-re-mi“ und auf der letzten Silbe eine verkürzte Form des ursprünglichen Melismas. Die Neume des 3. Akzent kann je nach Text variiert sein, nicht selten ist der Gipfelton „mi“ durch Epiphonus unterdrückt.
Bei vier Akzenten wird nach derkurrenten Akzentneume „do-la-do-do-do“ auf der letzten Silbe die verkürzte Neume des 3. Akzentes wiederholt und mit einer Wendung aus dem Beginn des ursprünglichen Melismas abgeschlossen.
GR2 TER
📘 📙 📗 📕

 Der Dreh- und Angelpunkt des GR2 TER ist der PesSpp (Pes suprapunctis „do-la-do-re“, auf ihm steht der letzte Akzent. Auf der letzten Silbe folgt das 28-tonige Melisma. Bei PPO wird der PesSpp auf zwei Silben aufgeteilt, bei O (Oxytonon) verschmelzen PesSpp und Melisma.
Der Dreh- und Angelpunkt des GR2 TER ist der PesSpp (Pes suprapunctis „do-la-do-re“, auf ihm steht der letzte Akzent. Auf der letzten Silbe folgt das 28-tonige Melisma. Bei PPO wird der PesSpp auf zwei Silben aufgeteilt, bei O (Oxytonon) verschmelzen PesSpp und Melisma.
 Das Incipit des Cento verwendet Salicus „fa-sol-la“, ClmRes „do-si-la-si“ und Pes „sol-la“. Bei zweiakzentigen Texten sind Salicus und ClmRes verschmolzen, bei PPO ist der Pes auf zwei Silben aufgeteilt, bei steiler Fügung ist auch noch der Pes zur ersten Akzentneume angegliedert (e.g. 0253).
Bei dreiakzentigen Texten erhält der zweite, mittlere Akzent den ClmRes, dem aber ein zusätzliches “la“ vorgesetzt ist. Hat der dreiakzentige Text keine praetonische Silbe, ist also bereits die erste Silbe der erste Akzent, so wird der Salicus durch FML alloq ersetzt.
In den Gradualien der Osteroktav ist das Incipit gegenüber der Normalform übersteigert, der Schlussteil aber entspricht der Norm.
Das Incipit des Cento verwendet Salicus „fa-sol-la“, ClmRes „do-si-la-si“ und Pes „sol-la“. Bei zweiakzentigen Texten sind Salicus und ClmRes verschmolzen, bei PPO ist der Pes auf zwei Silben aufgeteilt, bei steiler Fügung ist auch noch der Pes zur ersten Akzentneume angegliedert (e.g. 0253).
Bei dreiakzentigen Texten erhält der zweite, mittlere Akzent den ClmRes, dem aber ein zusätzliches “la“ vorgesetzt ist. Hat der dreiakzentige Text keine praetonische Silbe, ist also bereits die erste Silbe der erste Akzent, so wird der Salicus durch FML alloq ersetzt.
In den Gradualien der Osteroktav ist das Incipit gegenüber der Normalform übersteigert, der Schlussteil aber entspricht der Norm.
GV2 INC
Der Cento GV2 INC unterscheidet in erster Linie, ob der Text anfangs oder am Ende hauptbetont ist ( f vel i ).
Bei GV2 INC f trägt der letzte Akzent ein 36-toniges Melisma, Tonraum „sol-fa ad re“. Auf der Schlussilbe folgt eine Clv „mi-re“. Bei PPO verliert das Melisma den letzten, den Resupin-Ton, die Clv steht auf der Binnensilbe, es folgt ein supervenientes „re“. In 0171 wird das Oxytonon berücksichtigt „portabunt té“ indem die Clv zum Cephalicus reduziert ist und somit vor der der Endsilbe leicht staut.
Bei GV2 INC i tragen die letzten beiden Silben 11 bzw. 14 Töne. Ist das Wort „dó-mi-no“ (PPO) der Text, werden die 11 Töne der vorletzten Silbe unter Einfügung eines unisonischen „do“ auf 7+5 aufgeteilt.
 Der Cento beginnt mit dem Aufstieg „la-do-re“, dabei bereitet die letzte Silbe vor dem Melisma mit kPes „re-mi“ diese vor. Der Fluss („Caeli enárrat“) kann aber auch durch Epiphonus vor dem Akzent gestaut sein (“Potens in) térra“). Die Aufstiegstöne „do“ und „re“ sind meist mit Portamento emotionalisiert („Si me-i non fuerint dominati“). 0224 weicht der Textgestalt entsprechend von der Norm ab. Im GR 0228 wird das Schlüsselwort „lapidem“ mit einer kleinen Floskel hervorgehoben. Der Hauptakzent steigt mit Portamento zur Quart auf: „Lapidem quem reproba-vé-runt aedificantes“.
Der Cento beginnt mit dem Aufstieg „la-do-re“, dabei bereitet die letzte Silbe vor dem Melisma mit kPes „re-mi“ diese vor. Der Fluss („Caeli enárrat“) kann aber auch durch Epiphonus vor dem Akzent gestaut sein (“Potens in) térra“). Die Aufstiegstöne „do“ und „re“ sind meist mit Portamento emotionalisiert („Si me-i non fuerint dominati“). 0224 weicht der Textgestalt entsprechend von der Norm ab. Im GR 0228 wird das Schlüsselwort „lapidem“ mit einer kleinen Floskel hervorgehoben. Der Hauptakzent steigt mit Portamento zur Quart auf: „Lapidem quem reproba-vé-runt aedificantes“.

GV2 MED
📘 📙 📗 📕
 Der Cento GV2 MED ist nicht unähnlich dem Incipit strukturiert. Ein 22-toniges Melisma liegt auf dem letzten, dem Hauptakzent. Bei PPO spaltet sich der letzte Ton „la“ ab und wird zum Trc „la-do-la“ auf der Binnensilbe.
Der Cento GV2 MED ist nicht unähnlich dem Incipit strukturiert. Ein 22-toniges Melisma liegt auf dem letzten, dem Hauptakzent. Bei PPO spaltet sich der letzte Ton „la“ ab und wird zum Trc „la-do-la“ auf der Binnensilbe.
 Der erste, weniger wichtige Akzent (Tonraum „re-fa-re“) ist mit einer 7-Ton-Neume geschmückt. Ist der erste Akzent nicht die erste Silbe, so wird der erste Ton der Neume abgespalten und der Rest reduziert sich um einen Durchgangston ( ergo PrrSbp „fa-re-fa-mi-re“). Die letzte Silbe vor dem Schlussmelisma ist wieder kPes „re-mi“, wenn der Text ungebremst fließen soll. Der Epiphonus staut vor dem letzten Akzent.
Der erste, weniger wichtige Akzent (Tonraum „re-fa-re“) ist mit einer 7-Ton-Neume geschmückt. Ist der erste Akzent nicht die erste Silbe, so wird der erste Ton der Neume abgespalten und der Rest reduziert sich um einen Durchgangston ( ergo PrrSbp „fa-re-fa-mi-re“). Die letzte Silbe vor dem Schlussmelisma ist wieder kPes „re-mi“, wenn der Text ungebremst fließen soll. Der Epiphonus staut vor dem letzten Akzent.
 . In 0224 und 0225 ist „quóniam bónus“ mit einem eigenen Melisma zu „sol“ ausgeschmückt, andet aber wieder im Das Ende des Cento landet aber wieder mit dem Ende des üblichen Melisma.
. 0247 Der überlange Text erfordert einen melodischen Einschub „aquae usque ad animam“ - „Das Wasser steht mir bis zum Hals“. Der Schluss ist wieder die Norm.
. 0228 Der ‚Stein, der zum Eckstein geworden ist‘ hat schon im INC eine Soncderbehandlung erhalten. Hier im MED könnte der Text wie üblich vertont sein, aber dann würde der Akzent „caput“ - ‚Eckstein‘ in der Rezitation „re“ verblassen. So wird die wesentliche Aussage „hic factus est)“ mit einem großen Melisma abgefangen und auch das Wort „caput“ erhält seinen Schmuck. Die Einleitung ist dem INC entnommen, der Schluss ist wieder (fast) das übliche Melisma. Woher und ob diese Einschübe Zitate sind, lässt sich vorläufig nicht feststellen.
. In 0224 und 0225 ist „quóniam bónus“ mit einem eigenen Melisma zu „sol“ ausgeschmückt, andet aber wieder im Das Ende des Cento landet aber wieder mit dem Ende des üblichen Melisma.
. 0247 Der überlange Text erfordert einen melodischen Einschub „aquae usque ad animam“ - „Das Wasser steht mir bis zum Hals“. Der Schluss ist wieder die Norm.
. 0228 Der ‚Stein, der zum Eckstein geworden ist‘ hat schon im INC eine Soncderbehandlung erhalten. Hier im MED könnte der Text wie üblich vertont sein, aber dann würde der Akzent „caput“ - ‚Eckstein‘ in der Rezitation „re“ verblassen. So wird die wesentliche Aussage „hic factus est)“ mit einem großen Melisma abgefangen und auch das Wort „caput“ erhält seinen Schmuck. Die Einleitung ist dem INC entnommen, der Schluss ist wieder (fast) das übliche Melisma. Woher und ob diese Einschübe Zitate sind, lässt sich vorläufig nicht feststellen.
GV2 NOV
 Das Schlussmelisma des Cento GV2 NOV ist zweiteilig, 15 Töne auf dem letzten Akzent, 16 Töne auf der Schlusssilbe. Bei PPO wird zwischen beiden ein supervenientes „la“ eingeschoben. Der Unterschied von accentus maior finalis vel incipiens ist durch den ersten Teil des Melismas dargestellt.
Das Schlussmelisma des Cento GV2 NOV ist zweiteilig, 15 Töne auf dem letzten Akzent, 16 Töne auf der Schlusssilbe. Bei PPO wird zwischen beiden ein supervenientes „la“ eingeschoben. Der Unterschied von accentus maior finalis vel incipiens ist durch den ersten Teil des Melismas dargestellt.
Die den Cento eröffnende Rezitation „do“ beginnt mit Bivirga. Die letzte Silbe vor dem Melisma ist wie in GV2 INC und MED ein kPes, hier „do-re“. Auch er kann zum Cephalicus reduziert sein, um den folgenden Hauptakzent zu verstärken.

Bei accentus maior incipiens wird aus der Bivirga ein dreitoniger Pes „do-do-re“. Die bloße Bivirga in 0214 und 0276 weist eher auf Fehlen eines Hauptakzentes hin.
. So auch in 0230. Im Kontext ist das offensichtlich: „qui sedes super cherubim áppare - coram éfrem, beniamín et manasse.“ Die Aufzählung dreier Stämme Israels steht völlig im Schatten des Imperativs „áppare“. Dem Namen „éfrem“ doch eine Art Akzent zu geben, verwendet der Cento den kPes zur Quart aus dem INC von 0230. Das Melisma ist eine Variante von GV2 NOV i. . 0247 Der Text ist 3akzentig. Dieser Cento GV2 NOV verwendet deshalb das Material GR2 NOV, wo dreiakzentige Texte mehrmals vorkommen. Weiteres dazu siehe dort.
GV2 TER
📘 📙 📗 📕
 Der Cento GV2 TER ist nach den selben Regeln aufgebaut wie GR2 TER, nur das Melisma ist ein anderes. Es hat nur 17 Töne, hebt sich aber wie dieses als Mittelpunkt nk vom „do“ zum „re“ und schließt mit nkTrc-„la-do-la„ (re-fa-re).
Der Cento GV2 TER ist nach den selben Regeln aufgebaut wie GR2 TER, nur das Melisma ist ein anderes. Es hat nur 17 Töne, hebt sich aber wie dieses als Mittelpunkt nk vom „do“ zum „re“ und schließt mit nkTrc-„la-do-la„ (re-fa-re).

Besonderheiten bieten nur
. 0165 und 0233, die beim letzten Akzent „fírma-mén-tum den letzten Ton durch Epiphonus abschneiden und somit stauen und der Akzentsilbe selbst etwas mehr Gewicht geben. Ähnlich in
. 0247 Hier ist die Clv der Akzentsilbe „sub-stán-tia“ zur Bivirga geworden. Die Liqueszenz des zweiten Tons verhindert das tiefere „la“.
. 0229 Die variierte FML alloq wird dem Cursus gerecht:
„ét illúxit nóbis“ POPO „illúxit nóbis“ ist dem Cursus entsprechend nicht möglich, also wird der Text als „ét illuxit nóbis“, c.trispondiacus verstanden.Nun ist aber die Hauptaussage „illúxit“ vernachlässigt. Dem verschafft der Epiphonus an Stelle des kPes Abhilfe. Der Stau des Epiphonus betont nun „illúxit“, obwohl eigentlich doch c.trispondiacus.