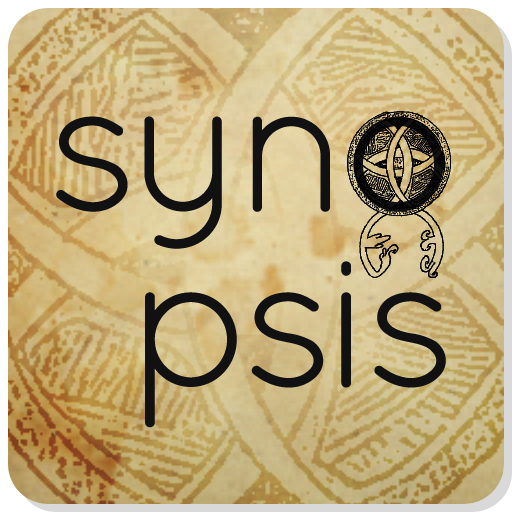| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| or-oc [2023/11/03 12:17] – xaverkainzbauer | or-oc [2024/07/07 18:50] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
|---|
| |
| |
| Ostfränkische – westfränkische Tradition | Ostfränkische – Westfränkische Tradition |
| |
| |
| Die um und vor **800** im Frankenreich redigierten Melodien wurden im 10.Jahrhundert erstmals linienlos aufgeschrieben. Schon im 10. Jahrhundert zeigt sich eine leichte Veränderung im Zugriff auf die Kompositionen (2). Im 11.Jahrhundert wird die "do-Revision" sichtbar, früher 'germanischer Choraldialekt' genannt, aber auch die "plerosis", das Auffüllen von Intervallsprüngen zu Tonleitern (e.g.: Kyrie orbis factor, Fassung A X.s, Fassung B XIV.s). Vor allem die Erkenntnisse zur "Artikulation", den rhythmischen Hinweisen in den frühen adiastematischen Quellen (C, L, H) die klar machen, dass es kurrente und nicht kurrente Neumen (Silben) gibt, waren neu. Aber auch dass diese Erkenntnisse bereits in adiastematischen Quellen vernachlässigt werden (Ch, MR) und in den diastematischen Quellen völlig vergessen werden (A,Y, Bv...), wurde sichtbar. Dazu hat keine dieser Erkenntnisse bis heute ihren Weg in die praktischen Ausgaben gefunden. Es ist an der Zeit den cantus gregorianus neuerlich und von Grund auf, unabhängig von den traditionellen Ausgaben zu hinterfragen. | Die um und vor **800** im Frankenreich redigierten Melodien wurden im 10.Jahrhundert erstmals linienlos aufgeschrieben. Schon im 10. Jahrhundert zeigt sich eine leichte Veränderung im Zugriff auf die Kompositionen (2). Im 11.Jahrhundert wird die "do-Revision" sichtbar, früher 'germanischer Choraldialekt' genannt, aber auch die "plerosis", das Auffüllen von Intervallsprüngen zu Tonleitern (e.g.: Kyrie orbis factor, Fassung A X.s, Fassung B XIV.s). Vor allem die Erkenntnisse zur "Artikulation", den rhythmischen Hinweisen in den frühen adiastematischen Quellen (C, L, H) die klar machen, dass es kurrente und nicht kurrente Neumen (Silben) gibt, waren neu. Aber auch dass diese Erkenntnisse bereits in adiastematischen Quellen vernachlässigt werden (Ch, MR) und in den diastematischen Quellen völlig vergessen werden (A,Y, Bv...), wurde sichtbar. Dazu hat keine dieser Erkenntnisse bis heute ihren Weg in die praktischen Ausgaben gefunden. Es ist an der Zeit den cantus gregorianus neuerlich und von Grund auf, unabhängig von den traditionellen Ausgaben zu hinterfragen. |
| |
| Unsere vergleichenden Tableuas der wichtigsten Zeugen von 900 bis 1300 ermöglichen eine Blick auf die Veränderungen des Cantus in dieser Zeit, den Wandel von subtiler Sprachlichkeit (stylo verbo melodico) zum Cantus planus des 13. Jahrhunderts, dem jede rhythmische und melodische Subtilität fehlt. Die Cento-Analysen im Aniphonen- und Responsorialrepertoire ermöglichen es uns erstmals, die einzelnen Neumen nicht nur in den Parallelstellen der anderen Handschriftem zu vergleichen, sondern auch in allen Paralellstellen der selben Handschrift. Das ergibt einen neuen Blickwinkel. Zum Beispiel ein Quilismascandicus wird nicht mehr aus den Quellen des 12. Jahrhunderts interpretiert, sondern aus den Parallelstellen der selben adiastematischen Hanschrift und wird deshalb zu Pes quilismaticus. Es wird sichtbar, dass Quilisma und Oriscus zwar Neumen, aber keine Töne sind. Vier wesentliche Erkenntnisse haben sich aus dem Cento-Vergleich gewinnen lassen: | Unsere vergleichenden Tableuas der wichtigsten Zeugen von 900 bis 1300 ermöglichen eine Blick auf die Veränderungen des Cantus in dieser Zeit, den Wandel von subtiler Sprachlichkeit (stylo verbo melodico) zum Cantus planus des 13. Jahrhunderts, dem jede rhythmische und melodische Subtilität fehlt. Die Cento-Analysen im Antiphonen- und Responsorialrepertoire ermöglichen es uns erstmals, die einzelnen Neumen nicht nur in den Parallelstellen der anderen Handschriftem zu vergleichen, sondern auch in allen Paralellstellen der selben Handschrift. Das ergibt einen neuen Blickwinkel. Zum Beispiel ein Quilismascandicus wird nicht mehr aus den Quellen des 12. Jahrhunderts interpretiert, sondern aus den Parallelstellen der selben adiastematischen Hanschrift und wird deshalb zu Pes quilismaticus. Es wird sichtbar, dass Quilisma und Oriscus zwar Neumen, aber keine Töne sind. Vier wesentliche Erkenntnisse haben sich aus dem Cento-Vergleich gewinnen lassen: |
| |
| Das **Quilisma** ist ein Intervallzeichen in einer linienlosen Notenschrift (altius in der karolingischen Minuskel). Mit der Einführungen der Linien verdunstet es. Die Zisterzienser kennen kein Quilisma mehr, nur die St.Galler Tradition verwendet es weiter, bleibt aber eben auch weiterhin adiastematisch. Die plerosis besetzt nun den herrenlosen Raum zwischen den beiden Tönen des Terzpes.\\ | Das **Quilisma** ist ein Intervallzeichen in einer linienlosen Notenschrift (altius in der karolingischen Minuskel). Mit der Einführungen der Linien verdunstet es. Die Zisterzienser kennen kein Quilisma mehr, nur die St.Galler Tradition verwendet es weiter, bleibt aber eben auch weiterhin adiastematisch. Die plerosis besetzt nun den herrenlosen Raum zwischen den beiden Tönen des Terzpes.\\ |